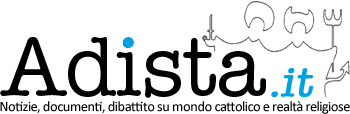"Wieder ich selbst": Vom Missbrauch in der Familie Mariens zur Freiheit
FREIBURG-ADISTA: „Die Gnade setzt die Natur voraus. Sie zerstört sie nicht, sondern vervollkommnet sie.“ Mit einem Zitat des heiligen Thomas von Aquin beginnt das im Juni in Deutschland bei Herder erschienene Buch von Birgit Abele, Wieder ich selbst. Mein Weg aus dem Gefängnis spirituellen Missbrauchs. Ein Titel, der einen Kontrapunkt zu einem anderen Buch über Missbrauch zu setzen scheint, das vor einigen Jahren in Deutschland erschienen ist, Nicht mehr ich, von der Theologin Doris Wagner, die von den Abgründen des sexuellen Missbrauchs durch einen Priester berichtet.
Birgit Abele, eine Deutsche, die in eine katholische Familie hineingeboren wurde und heute als psychologische Beraterin Opfer von spirituellem Missbrauch begleitet, schildert ihre Geschichte: 23 Jahre auf der Suche nach Gott, die sie in einer religiösen Gemeinschaft verbracht hat, in der sie - ohne sie damals als solche zu erkennen - schwere sektiererische Abwege, psychologische und spirituelle Gewalt und ein tyrannisches Herrschaftssystem erlebt hat, das auf einer verzerrten Vorstellung von Gehorsam (und der Suche nach Heiligkeit) beruht. Sie tut dies, ohne die Identität der Gemeinschaft oder der beteiligten Personen preiszugeben, indem sie mit außergewöhnlicher Gelassenheit alle Namen ändert. Aber was sie sagt, klingt den Lesern von Adista sehr vertraut, da die Gemeinschaft, von der sie spricht, leicht zu erkennen ist an ihren vielen einzigartigen Elementen, (wie die deutsche katholische Zeitung Tagespost hervorhebt, 1/8), die Familie Mariens, eine Vereinigung von Gläubigen mit einer sehr umstrittenen Vergangenheit und Gegenwart, die derzeit zusammen mit ihrem priesterlichen Arm (dem Werk Jesu des Hohenpriesters) vom Vatikan unter Vormundschaft gestellt wurde und über die wir seit zwei Jahren eine Untersuchung durchführen und ehemalige Mitglieder und Zeugen zu Wort kommen lassen.
So ist derjenige, den die Autorin im Buch als „Pater Bonifatius“, ihren geistlichen Leiter und Oberen, bezeichnet, in Wirklichkeit kein anderer als der Mitbegründer, geistliche Leiter und Obere der Gemeinschaft, Pater Gebhard Paul Maria Sigl, gegen welchen der Vatikan derzeit ermittelt; und Mutter Agnes, die heute ebenfalls entlassen wurde, wird in der Geschichte zu „Schwester Angelika“. Der literarische Kunstgriff, die Gemeinschaft zu „entpersonalisieren“, ermöglicht es jedoch (und das ist einer der großen Werte des Buches), einen Wegweiser für all jene Menschen zu markieren, denen es, in und außerhalb ähnlicher von Sektierertum und Missbrauch geprägter Gemeinschaftssituationen, schwerfällt, das zu sehen, zu erkennen und zu benennen, was sie erleben oder erlebt haben.
Erkennen von Missbrauch
Warum ist es so schwierig, Missbrauch zu erkennen? Birgit Abele erklärt es sehr anschaulich, indem sie kleine und große Situationen und Episoden aus ihrem Gemeinschaftsleben schildert, das mit Anfang zwanzig, etwa Mitte der 1990er Jahre, begann und in einem geschlossenen System des blinden Gehorsams gegenüber Vorgesetzten gelebt wurde, die ihren eigenen Willen als den Willen Gottes ausgaben und im Namen dieses Willens die Aufhebung der Persönlichkeiten der Mitglieder verlangten; eine Latte, die jeden Tag höher und höher zu legen war, unter Androhung von Ausgrenzung, Demütigung und emotionaler Desinvestition. Die von „Pater Bonifatius“ Gebhard Sigl vermittelte Ausbildung zielte darauf ab, Wünsche und Bedürfnisse, selbst elementare, mit einer hinterhältigen und akribischen Strategie auszulöschen und von sich selbst in einer immer perfektionistischeren und zwanghafteren Weise eine totale Übereinstimmung mit den Erwartungen der Vorgesetzten, d.h. Gottes, zu verlangen; dies führt dazu, dass Birgit jede Dimension ihres Lebens vergeistigt, immerwährende Schuldgefühle empfindet, ihr Selbstwertgefühl allmählich auslöscht und die Zeichen des Leidens an ihrem Körper vernachlässigt.
Auf diese Weise erkrankt Birgit an einem lähmenden und schwächenden Unwohlsein, das sie jahrelang erdrückt und das sie nach dem Willen ihrer Oberen im Geiste der Miterlösung Gott aufopfern soll. Gelingt ihr das nicht immer und sucht sie selbst nach Lösungswegen, wird dies in der Gemeinschaft lange Zeit als Zeichen eines schlechten Willens oder einer Glaubensschwäche abgetan. Was in Birgits Geschichte auffällt, ist der krasse Gegensatz zwischen dem anfänglichen Schwung, dem geistlichen Enthusiasmus, mit dem sie sich für das Gemeinschaftsleben entscheidet (und wie sie auch so viele großzügige junge Menschen), bereit sogar sich selbst zu entbehren und Opfer zu bringen im Namen des Traums, ihr Leben Gott zu weihen, und dem allmählichen Auslöschen ihrer Individualität, ihrer Träume, ihrer Talente, das das Feld für einen „willenlosen“, passiven Gehorsam offen lässt; und nachfolgend für Angst, Furcht, Einsamkeit. Die angebliche Gnade, die, im Widerspruch zum heiligen Thomas, die Natur zermalmt, ist eine verfälschte, unauthentische Gnade, denn sie ist die Frucht einer elitären Vorstellung der Gemeinschaft, die als einziges geistiges Bollwerk des Heils verstanden wird in einer irdischen Welt, von der man nur das Böse sieht und die bald von einem Eingriff Gottes heimgesucht werden wird.
Birgit kümmert sich nicht mehr um ihr Leben, denn in der Verletzung ihrer individuellen, psychischen und geistigen Sphäre, die ihr vor allem von ihrem Vorgesetzten Pater Sigl zugefügt wird, der auch ihr Seelsorger ist (in einer Rollenüberschneidung, die die Kirche längst verurteilt hat), hat ihr Leben, Birgits Leben, jeden Sinn verloren. Er ist es, der jede Entscheidung für sie trifft, von der kleinsten bis zur wichtigsten; er ist es, den man um Erlaubnis für alles fragen muss.
Es sind Jahre tiefen Leidens, innerer Vernichtung, emotionaler, geistiger und affektiver Entbehrung im Namen einer göttlichen Liebe, reiner Formalität und Äußerlichkeit, die zum Widerspruch, zur Verleugnung des Menschseins, zur Unmenschlichkeit geworden ist.
Doch Birgits Weg macht eine Biegung, die im Grunde genommen ein Licht offenbart, und zwar in dem Moment, in dem die Krankheit ihr eine physische Distanzierung von der Gemeinschaft auferlegt. Dort, in der Konfrontation mit der Außenwelt, im Hören auf sich selbst, beginnt sie zu sehen, zu verstehen und zu heilen. In der Beziehung zu Therapeuten, zu Außenstehenden, zu anderen Büchern als dem Leben der Heiligen - der einzigen erlaubten Lektüre -, zur Geschichte, die in jenen Jahren an ihr vorbeizog, ohne dass sie es bemerkte, eingesperrt in einer Parallelwelt, sieht Birgit eine Zukunft für sich. Eine Ausbildung, ein Beruf, eine Entfaltung ihrer Talente, deren Dimensionen bisher in der einfachen und eintönigen Arbeit eines „Dienstmädchens“ für die edle Sache der Heiligung der Priester der Gemeinschaft gedemütigt wurden. Sie bittet um ein Studium und erhält es zu einem hohen Preis; sie schließt es ab, macht weiter und erwirbt eine Kompetenz in psychologischer Begleitung, die sie in der Gemeinschaft einsetzen könnte, angesichts so vieler Situationen mehr oder weniger verschleierten Leidens, die ihr ähnlich sind und durch die Giftigkeit des Umfelds verursacht werden; sie beschließt, zu gehen, als ihr all dies verwehrt wird und sie sich mit einem „entweder... oder…“ konfrontiert sieht. Für „Pater Bonifatius” ist Birgit mit ihrer nun entwickelten Autonomie des Denkens und ihrer erworbenen individuellen spirituellen Verantwortung nun eine Gefahr für die Gemeinschaft, in der das einzige Gesetz ist: nur der Gedanke ihres Vorgesetzten gilt, der einzige Interpret des Willens Gottes, und in der das Mantra lautet: „Da draußen bist du niemand“.
Birgit findet sich in einer neuen Welt wieder und muss zum ersten Mal lernen, zu leben. Sie kämpft mit der Einsamkeit, mit den Zeiten des „normalen“ Lebens, mit Rechnungen, die sie bezahlen muss, aber sie findet die Antwort auf ihre Kämpfe darin, dass sie ihr eigenes Lebensgepäck Menschen zur Verfügung stellt, die wie sie leiden. Wer kann sie besser verstehen und ihnen helfen als sie?
Nachfolgend finden Sie mit freundlicher Genehmigung des Verlags Herder und der Autorin Auszüge aus dem Buch, das ein Vorwort von Peter Hundertmark, promovierter Philosoph, Pastoralreferent, Geistlicher Begleiter, tätig in der Abteilung Geistliche Bildung/Exerzitien im Bischöflichen Ordinariat Speyer und bekannt durch den von ihm betriebenen Blog, enthält; und ein Nachwort der Theologin Barbara Haslbeck von der Universität Regensburg, die die vier Ressourcen hervorhebt, die Birgit geholfen haben ihr persönliches Leben wieder in den Griff zu bekommen und sich von einem ungesunden Gemeinschaftsleben zu befreien: Auf Leib und Seele hören, Kontakt mit der Außenwelt haben, studieren und sich weiterbilden, selbständig Entscheidungen treffen.
Die Gnade setzt die Natur voraus. Sie zerstört sie nicht, sondern vervollkommnet sie.
Wieder ich selbst
Birgit Abele
Mein Buch steht für die vielen Leidtragenden, die nicht den Mut oder die Kraft haben, ihre Erfahrungen aufzuschreiben. Möge es dazu beitragen, geistlichen Missbrauch schneller zu entlarven und Opfer zu schützen. Verantwortliche in der Kirche dürfen nicht länger wegschauen oder das Phänomen bagatellisieren, denn mittlerweile ist bekannt, dass spiritueller Missbrauch genauso tief in die Persönlichkeit eingreifen und ebenso verheerende Auswirkungen auf das Selbstbild und die Lebensfähigkeit der Betroffenen haben kann wie sexueller Missbrauch. (p. 13)
Ohne Gott bin ich nichts P. Bonifatius forderte uns auf, „große Beter“ und „Anbeter“ zu werden. Was wir ohne das Gebet seien, drückte er immer wieder mit dem Satz aus: „Ich bin nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts – ohne Gott“. „Ohne Gott bin ich nichts“, das sollten wir uns bei allem, was wir tun, vor Augen halten und nicht auf unser eigenes Können oder Wissen zählen. Das Gebet hatte daher eine sehr hohe Relevanz und wurde über alles andere gestellt. Drei Rosenkränze am Tag waren verpflichtend. Die Gebetszeiten wurden immer mehr ausgedehnt, sodass die Relation zwischen Gebet, Arbeit und Erholung unverhältnismäßig wurde. Fünf bis sechs Stunden tägliches Gebet stellten sich als völlig normal dar. Padre lehrte uns, unser Ich müsse ganz ausgelöscht werden, damit Gott den ganzen Platz in uns einnehmen könne. Eigene Wünsche und Bedürfnisse sollten deshalb aufgegeben werden. Er hielt uns an, nicht zu denken, sondern nur zu lieben. Auch legte er uns nahe, nicht auf unsere Gefühle zu achten, da diese uns täuschen könnten. Allein der Wille sei entscheidend.
Wie ich heute weiß, widerspricht eine solche Auffassung einer authentisch-christlichen Mystik. Diese schließt immer alle Aspekte des Menschseins, also Leib, Seele und Geist, mit ein. Besonders für die Unterscheidung der Geister nach dem heiligen Ignatius von Loyola spielt die Wahrnehmung der eigenen Gefühle eine zentrale Rolle. Gott wirkt durch unser Selbst und unsere Persönlichkeit. „Die Gnade setzt die Natur voraus“, sagte schon der heilige Thomas von Aquin, „sie zerstört sie nicht, sondern vollendet sie.“ Ich erlebte hingegen, dass sich bei vielen in der Gemeinschaft keine gesunde Per129 Verlag Herder GmbH sönlichkeit entwickeln konnte oder gar einzelne Teile der Persönlichkeit unterdrückt wurden. Manche zerbrachen unter der Last des Systems. Wenn der Mensch stattdessen in seinem Ganz-Sein beachtet wird und sich entfalten darf, erhält er alles, was er zum Leben braucht. Aus meiner heutigen Sicht frage ich mich: Setzen sich Leitende durch eine Entwertung des Menschlichen nicht letztendlich über den Schöpfer hinweg, der den Menschen nicht nur mit Geist, sondern mit Körper, Gefühlen und Bedürfnissen versehen hat? (pp. 129-130)
Keine weltliche Hilfe suchen
In der Gemeinschaft erfuhr nicht nur das Menschliche, sondern auch das Weltliche eine starke Abwertung. Das Irdische wurde von den Oberen als Gegenpol zum Göttlichen dargestellt. Wir sollten möglichst keine weltliche Hilfe suchen, sondern alles allein von Gott erwarten. P. Bonifatius würdigte Humanwissenschaften, insbesondere die Psychologie, herab, ja im schlimmsten Fall stellte er sie als Hindernis für das Wirken Gottes dar. Diesen Dualismus halte ich für gefährlich. Kann sich Gott nicht auch menschlichen Wissens und Könnens bedienen, um dadurch den Menschen seine Zuwendung zukommen zu lassen? Wird er durch ein solches Weltbild nicht in seinen Wirkungsmöglichkeiten begrenzt? (…) (p. 130)
Überhöhung der eigenen Spiritualität
Erst nach meinem Austritt stellte ich fest, dass die Welt gar nicht so schlecht war, wie sie in der Gemeinschaft dargestellt wurde. Es gab auch sehr viel Gutes und unglaublich liebevolle Menschen in ihr. Tatsächlich bekam ich hier sehr viel mehr Verständnis und Unterstützung als in der Gemeinschaft. Heute scheint mir dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken auch ein Druckmittel zu sein, um den Mitgliedern Angst vor einem möglichen Austritt zu machen. Selbst die Kirche wurde in gut und schlecht eingeteilt. Gegenüber der Amtskirche herrschte Skepsis, ja sie wurde viele Male als verschlossen gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes dargestellt, nicht nur von den Oberen, sondern auch von den Mitgliedern. Selbst der Heilige Vater entsprach in den Augen von Padre nie vollkommen seiner Sendung, egal welcher Papst es war. Umso wichtiger schien unsere Berufung für die Erneuerung der Kirche und der Welt zu sein. Unsere Spiritualität galt als die beste und sollte daher allen Menschen vermittelt werden.
Mittlerweile weiß ich, dass es sich dabei um ein Phänomen handelt, das typisch für geistlich missbräuchliche Gemeinschaften ist und ein Merkmal für sektenähnliche Strukturen darstellt. Die Überhöhung der eigenen Spiritualität geht häufig einher mit einem christlich geprägten Größenwahn und Elitedenken. Nicht selten spielen dabei narzisstische Elemente eine Rolle, in die die ganze Gemeinschaft mit hineingezogen wird, ohne es zu merken. Wer ist nicht gern „etwas Besonderes“? Das Gefährliche daran sehe ich zum einem in der Entwicklung von geistlichem Stolz, der Überzeugung, mehr der „Gnade zu entsprechen“ als der Rest 132 Verlag Herder GmbH der Welt. Zum anderen geht Idealisierung immer mit Entwertung einher. Der bzw. das andere wird dann als weniger wertvoll angesehen, was ihm nicht gerecht wird. (pp. 132-133)
Nicht menschlich, sondern göttlich lieben
Diese Polarität zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen zeigte sich auch in der Forderung nach absoluter Nächstenliebe. Unsere Oberen schärften uns ein, den anderen nicht menschlich, sondern göttlich zu lieben. Solche überirdische Liebe sollten wir im Gebet und in der heiligen Kommunion empfangen. Wo genau die Grenze zwischen menschlicher und göttlicher Liebe liegt, wurde mir nie ganz klar. „Darf ich eine Schwester, die sehr müde aussieht, fragen, wie sie geschlafen hat, oder ist dies zu menschlich?“, fragte ich mich manchmal. Können wir Menschen überhaupt nur „göttlich“ lieben, ohne dass wir dabei menschliche Liebe empfinden? Ist es nicht eher so, dass die göttliche Liebe unser menschliches Lieben befruchtet und inspiriert? Leider konnte der überaus hohe Anspruch nach grenzenloser Liebe oft nicht mit der Realität Schritt halten. Viele Male verblieb das krampfhafte Bemühen, nach außen hin liebevoll zu erscheinen, während die innere Wirklichkeit ganz anders aussah, nach dem Motto: „Ich muss dich lieben, auch wenn ich dich nicht mag.“ Auch hier scheint mir: Wird das Zentrum der Aufmerksamkeit zu einseitig auf das Geistliche gelegt, gerät das Menschliche ins Hintertreffen, das Miteinander wird dann „unmenschlich“.
Trotz der normalen menschlichen Schwächen fühlte ich mich mit allen Schwestern und Brüdern der Gemeinschaft innig verbunden. Nie zuvor und nie danach erlebte ich so ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit. Ich hielt es für Liebe. Heute würde ich sagen, es war Bindung. Obgleich innerhalb der Kommunität eine liebevolle Atmosphäre gepflegt wurde, fiel man aus dieser bedingungslosen Zuneigung heraus, sobald 133 Verlag Herder GmbH man den Anforderungen nicht gerecht wurde oder eine andere Meinung vertrat als gewünscht. Auch wenn sehr viel über Liebe geredet wurde und alle sich um „Liebe“ bemühten, halte ich diesen Begriff nicht für passend, denn: „Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17). Nur wenn Liebe die andere Person freilässt und ihr Wohlergehen im Blick hat, verdient sie diesen Namen.
Wenn wir innere Nöte hatten, sollten wir uns nur Padre und Madre oder evtl. noch dem Priester in unserer Station anvertrauen, keineswegs aber mit Mitschwestern oder -brüdern darüber sprechen. Was in den anderen vorgeht, was sie gerade beschäftigt und worunter sie leiden, war uns deshalb weitestgehend unbekannt. Nach außen hin sah man nur die Fröhlichkeit und das strahlende Lächeln. Häufig hatte ich das Gefühl, wir leben nebeneinanderher, ohne uns wirklich zu begegnen. Heute erfahre ich, dass es das Zusammenleben und ein liebevolles Miteinander enorm befruchtet, wenn man ein wenig Einblick in die innere Welt des Gegenübers hat. (p. 133-134)
Absoluter Machtanspruch
P. Bonifatius sagte einmal, er leite die Gemeinschaft und die Einzelnen ausschließlich durch die Erkenntnis, die er von Gott erhalte, nicht durch menschliche oder theoretische Überlegungen. Für uns war es deshalb umso wichtiger, in sehr engem Austausch mit ihm zu sein, um seine Eingebungen für uns zu empfangen. Dies konnte so weit gehen, dass er Postulantinnen sagte, sie hätten eine Berufung für das gottgeweihte Leben, ohne dass diese sich jemals innerlich dafür entschieden. Auch Schwestern, die nach reiflicher Überlegung den Entschluss gefasst hatten auszutreten, hielt er davon ab, indem er ihnen sagte, dies sei eine Versuchung des Feindes. Da alle glaubten, er höre die Stimme Gottes, schenkten sie ihm Vertrauen und hielten sich an seine Weisungen. Eigenen Gedanken und Empfindungen sollten wir immer mehr misstrauen. Selbst kleinere Entscheidungen waren in Absprache mit den Generaloberen zu treffen. Wie wichtig es sei, dieser Führung blind zu vertrauen, verdeutlichte P. Bonifatius eines Tages mit folgender Aufforderung: Wenn wir eine Wand sähen, die weiß sei, er sage uns aber, die Wand sei schwarz, müssten wir glauben, dass diese schwarz sei. Besonders wenn die schwere Zeit käme, sei es wichtig, uns seinen Anweisungen gänzlich zu überlassen. Sein besonderes Charisma machte er somit zur einzigen Richtschnur. Und genau hier sehe ich den Knackpunkt: Anstatt die Mitglieder in ihrem eigenen Suchen nach Gott zu unterstützen, setzte sich P. Bonifatius an die Stelle Gottes. Er trat in die geistliche Intimsphäre des Individuums ein und übernahm die Steuerung. Dadurch nahm er einen Bereich ein, der nur Gott zusteht. Er machte die Mitglieder von ihm abhängig und trennte sie von sich selbst. Hier geschieht genau das, was der Jesuit Klaus Mertes als Verwechslung geistlicher Personen mit der Stimme Gottes beschreibt (vgl. Klaus Mertes, Geistlicher Missbrauch. Theologische Anmerkungen, in: Stimmen der Zeit 2/2019, 93–102). Nicht nur der Leiter selbst verwechselt sich mit der Stimme Gottes, sondern auch die ihm Anvertrauten verwechseln ihn mit Gott. (…)
Im Laufe der Zeit beobachtete ich, wie sich manche Mitglieder der Gemeinschaft Persönlichkeitszüge der Oberen zu eigen machten, etwa im Übernehmen der Handschrift, der Mimik und Gestik, den Worten und der Art zu reden. Solche Verhaltensweisen wurden von den anderen Brüdern und Schwestern durchaus positiv bewertet, sie galten als „gelebte Einheit mit Padre und Madre“. Heute erschrecke ich darüber. P. Bonifatius und Sr. Angelika waren zum Idol geworden, dem die einzelnen nacheiferten, ohne zu merken, wie ihre eigene Persönlichkeit dadurch immer mehr ins Hintertreffen geriet. Dies entspricht nicht der Einzigartigkeit, mit der Gott jeden Menschen erschaffen hat! Sr. Angelika empfahl uns öfters, wenn wir nicht wüssten, wie wir am besten entscheiden oder handeln sollten, uns geistigerweise mit ihr oder mit P. Bonifatius zu vereinen, dann würden wir innere Klarheit bekommen. Das Maß aller Dinge waren immer mehr die Oberen, nicht Gott. Man wurde danach beurteilt, wie sehr man geistig mit den beiden verbunden war und in ihrem Sinne lebte. Wagte man es, Kritik an einer ihrer Entscheidungen zu üben, geriet man unter Generalverdacht. (pp. 135-136)
Verharmlosung seelischer Leiden
Den Umgang mit seelischen Verwundungen aus der Kindheit und deren psychische Folgen thematisierten die Oberen äußerst selten. Sie betonten diesbezüglich die heilende Gegenwart Jesu in der Anbetung. Padre sprach einmal davon, die Liebe Gottes zu uns sei so unermesslich groß, dass es geradezu lächerlich sei zu sagen, man habe von den Eltern nicht genügend Liebe bekommen. Wir sollten nicht in die Vergangenheit blicken, sondern nach vorne. Als Beispiel führte er die Frau des Lot an, die zur Salzsäule erstarrte, als sie noch einmal auf Sodom zurückschaute. Eine Aufarbeitung der eigenen Kindheit galt als ich-bezogen und unnötig. Wenn wir unter Traurigkeit und Ängsten litten, sollten wir diese mit der Todesangst Jesu im Garten Getsemani vereinen und Gott aufopfern. Das war lange Zeit das Credo. Von Psychologen hielt er nicht viel, er machte sich sogar einmal über sie lustig und sagte, sie bekämen viel Geld dafür, wenn sie den Patienten eine Stunde lang zuhörten. Ja, er behauptete sogar, wenn die Leute wieder mehr zur heiligen Beichte gingen, wären die Wartezimmer der Psychiater leer. Damit verharmloste er seelische Leiden. Erst als zunehmend Mitglieder unter Depressionen litten, legte uns Madre nahe, mit ihr oder mit Padre zu sprechen, wenn es uns innerlich nicht gut ginge. Den Betroffenen wurde dann ermöglicht, zu ganz bestimmten Psychotherapeuten zu gehen, die den Vorstellungen der Leitung entsprachen.
Heute erachte ich es als grundlegende Aufgabe des Menschen, sich seinen inneren Verwundungen zu stellen. Wer verletzt ist, verletzt. Nur wenn eigene schmerzhafte Erfahrungen angenommen und integriert werden, kann tiefe Heilung in der Beziehung zu sich selbst, den Mitmenschen und zu Gott geschehen. (p. 139)
Spirituelle Manipulation Was uns P. Bonifatius lehrte, ging zum größten Teil auf seine persönlichen Erfahrungen sowie auf Erlebnisse von Mystikern zurück. An die kirchliche, spirituelle Tradition wurde nicht angeknüpft. Theologische und spirituelle Abwege und Schieflagen waren die Folgen. Ein „Ahmt mich nach“ (Phil 3,17) wird niemals allen Mitgliedern gerecht. Vielmehr geht es darum, Christus nachzufolgen, und zwar so, wie es für die Einzelnen in ihrer Individualität angemessen ist. Der Einfluss der Oberen war immens. Sie galten als einzige Richtschnur in allen Angelegenheiten des geistlichen und profanen Lebens. P. Bonifatius bestimmte nicht nur über die Einrichtung der Kapellen und Außenanlagen der Häuser, sondern auch über das Aussehen der Schwesternkleidung, die Filme, die Bücher und die Musik, die verwendet werden dürfen, den Konsum von Alkohol, die Ausübung von Sport und sehr viele andere Themen des Gemeinschaftslebens. Beispielsweise legte er fest, dass wir Schwestern nur Heiligenbücher lesen sollten. Manchen erlaubte er nicht einmal das. Sr. Angelika sprach die meisten Entscheidungen mit P. Bonifatius ab und traf sie nur in seinem Sinne. Damit wurde sie einzig und allein zu seinem ausführenden Organ.
P. Bonifatius hatte für fast alle Mitglieder der Gemeinschaft die Funktion des Seelenführers. Aufgrund seiner zahlreichen, auch außergemeinschaftlichen Verpflichtungen und Reisen war er allerdings nur schwer zu erreichen. Er sagte einmal, seine Seelenführung erfolge auch durch seine Homilien, 140 Verlag Herder GmbH die regelmäßig aufgenommen und an alle Häuser verschickt wurden. Daraus entstand eine gewisse Verpflichtung, alle seine Predigten anzuhören, in Stoßzeiten konnte das auch täglich sein. Mitglieder tippten viele seiner Homilien ab und versendeten sie, ebenso Gebets- und Kreuzwegbetrachtungen von Sr. Angelika. In nahezu allen Gebetszeiten verwendeten die Schwestern und Brüder diese zur Betrachtung zwischen den Rosenkranzgesätzchen oder zu den Kreuzwegstationen. Somit waren wir von morgens bis abends in die Lehre der Gemeinschaft eingebettet und wurden restlos von ihr durchdrungen.
Wenn ein Priester nicht haargenau im Sinne dieser Lehre predigte, galt er als verdächtig. Eine eigene Meinung zu haben, die von der der Oberen abwich, wurde zum No-Go. Die meisten Mitglieder übernahmen ungeprüft die Anschauungen der Gemeinschaft, die einem allmählich zur zweiten Natur wurden. Eigenes Denken wurde somit ausgeschaltet. Die Manipulation war total und umfassend und wurde dadurch noch verstärkt, dass wir kaum Kontakte zu Personen außerhalb der Gemeinschaft hatten. Und wenn ja, dann vorwiegend zu Freunden und Wohltätern der Kommunität, die von unserer Arbeit begeistert waren. Bei all dem war ich der Überzeugung, die Lehre der Gemeinschaft sei durch und durch katholisch. Mittlerweile weiß ich, dass sie in manchem der katholischen Lehre widerspricht und vor allem das katholische „Sowohl-als-Auch“ vermissen lässt. Was mit uns geschah, kann mit dem Begriff der Gedankenumbildung beschrieben werden. Diese ist vergleichbar mit einer Gehirnwäsche, läuft aber subtiler ab und hält viel länger an. Wir wurden immer mehr zu Marionetten, die willenlos die Aufträge der Oberen ausführten. Ich fühlte mich wie in eine Schablone gepresst, in der ich als Person nicht mehr vorkam. Die Bedürfnisse des Einzelnen blieben auf der Strecke, denn die Gruppe war wichtiger als das Individuum, analog der Nazi-Doktrin: „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ (pp. 140-141).
Ich studiere!
(…) Das Studium brachte mich in Kontakt mit Menschen in ganz verschiedenen Lebenssituationen: Obdachlosen, psychisch Kranken, jugendlichen Straftätern, Sterbenden und vielen mehr. Ich lernte die Realität kennen und brach aus der geistigen Parallelwelt der Gemeinschaft aus. Das tat mir gut und half, meinen Horizont zu erweitern. Nur mit der Rechtssprache und den vielen Gesetzen konnte ich mich nie anfreunden. Unser Politik-Dozent legte Wert darauf, dass wir über das politische Tagesgeschehen Bescheid wussten, und setzte das für den Unterricht voraus. Wir Schwestern sollten uns jedoch nicht damit befassen. Nun befand ich mich in einem Gewissenskonflikt: Höre bzw. lese ich die Nachrichten oder nicht? Letztlich kam ich zu dem Schluss, dass das Lesen der Nachrichten auch zum Studium gehörte, damit gab ich mir quasi selbst die Erlaubnis, täglich die politischen Entwicklungen zu verfolgen. Anfangs hatte ich dabei ein schlechtes Gewissen. Einmal las ich bei einem Heiligen, er bete besonders gut, wenn er vorher die Nachrichten höre, um danach in diesen Anliegen zu beten. Das beruhigte mich. Sich zu informieren schien also nicht gegen den Weg zur Heiligkeit zu sein. 18 Jahre lang hatte ich keinen Zugang zu Nachrichten gehabt. In der Gemeinschaft stand uns gewöhnlich weder ein Fernseher noch ein Radio oder eine Tageszeitung zur Verfügung. Ins Internet durften wir nicht, beziehungsweise mussten wir die Hausmutter jedes Mal vorher fragen, wenn wir etwas nachschauen wollten. Infolgedessen fehlt mir heute das Wissen über bald 20 Jahre des politischen und sozialen Weltgeschehens. Die einzige „Nachrichtenquelle“ bestand in den Predigten von P. Bonifatius, der immer wieder auf bestimmte Ereignisse einging und sie in seinem Sinne interpretierte, nicht selten von irgendwelchen Verschwörungstheorien durchzogen. Wir bekamen nicht die Möglichkeit, uns eine unabhängige Meinung zu bilden. (…) (p. 188-189)
Immer höhere Anforderungen
(…) Als Sr. Angelika uns einmal an unserer Station besuchte, erzählte sie beim Morgengebet von zwei Schwestern im Mutterhaus, die sich an einen Extra-Tisch gesetzt hatten, während alle anderen Schwestern an einem anderen Tisch saßen. Dabei ermahnte sie uns, uns immer der Gemeinschaft unterzuordnen und nicht aus der Reihe zu fallen. Ich war schockiert. Wo blieb da Raum für die eigene Individualität und die persönliche Freiheit, wenn schon das Sitzen an einem anderen Tisch als verwerflich galt? Darüber hinaus wurde die Wahl von Papst Franziskus in der Gemeinschaft sehr kritisch gesehen. P. Bonifatius bezeichnete ihn sogar einmal als „Wolf im Schafspelz“. Diesen Entwicklungen stand ich sehr skeptisch gegenüber, mit vielem konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Ich fühlte mich in dieser Spiritualität immer weniger zuhause und war froh, meine eigene Wohnung zu haben, in der ich mir einen persönlichen Freiraum schaffen konnte. Auch fiel mir auf, dass immer mehr Mitglieder der Gemeinschaft an einer Depression erkrankten, psychosomatische Beschwerden entwickelten oder körperlich krank wurden. Ich sah Schwestern, die völlig überlastet waren und schließlich zusammenbrachen. Einmal hörte ich sogar von dem Suizidversuch einer Schwester, der aber totgeschwiegen wurde. Immer wieder beobachtete ich, wie Schwestern heimlich weinten. Eine Bekannte erzählte mir sogar von einer Person, die nach einem Gebetstag mit P. Bonifatius psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen musste. Hinter der glänzenden Fassade verbarg sich viel persönliches Leid. Dieser unschöne Teil der Gemeinschaft wurde nach außen hin nicht sichtbar. (p. 193)
Ein geschlossenes System
Während der Therapieausbildung wurde mir klar, dass es sich bei der Gemeinschaft der Liebe um ein geschlossenes System handelte. Gegenüber der Gesellschaft grenzte sie sich stark ab. Vieles, was innerhalb der Gemeinschaft gesagt wurde, sollte nicht nach außen getragen werden. Die Welt draußen wurde negativ bewertet, und es galt, sich vor ihr zu schützen. Im inneren Bereich überschritten die Verantwortlichen jedoch massiv die Grenzen der ihnen Anvertrauten. Sie respektierten weder die persönliche Spiritualität, den individuellen Zugang zu Gott, noch die daraus resultierende Eigenverantwortlichkeit in wichtigen Entscheidungen des Lebens. Dafür stülpten sie uns eine gewisse Einheitsspiritualität über, egal ob sie zu der Person passte oder nicht. Ich lernte, dass dies Merkmale für krankmachende Systeme sind. Mit jedem Tag verstand ich mehr, warum es mir darin nicht gut ging. Diese Einsicht gab mir zunehmend die innere Freiheit, mich von den sehr engen Vorgaben der Kommunität zu distanzieren. Insgesamt bestärkte mich die Ausbildung in Systemischer Therapie sehr auf meinem Weg in die spirituelle Selbstverantwortung. Mittlerweile durfte ich unter engmaschiger Supervision bereits erste eigene Klient/inn/en begleiten. Aus dem Umfeld der Gemeinschaft fanden sich schnell einige Interessenten, und ich richtete in meiner Wohnung einen kleinen Platz für die Durchführung der Therapiegespräche ein. Die Arbeit machte mir viel Freude und gab mir Sinn. Auch die Klient/ inn/en zeigten sich dankbar. Endlich schien sich das zu verwirklichen, wofür ich viele Jahre studiert hatte. Ich hatte den Eindruck, kurz vor dem Ziel zu sein. (p. 203)
Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.
Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.
Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.
Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!